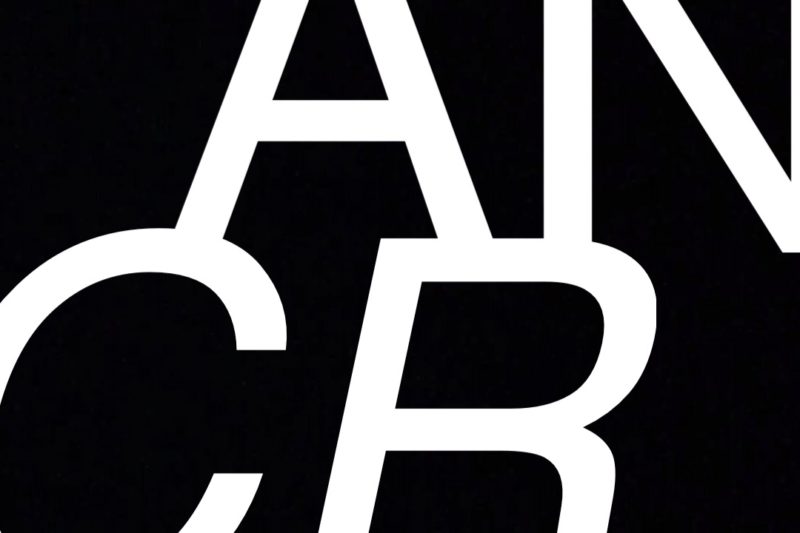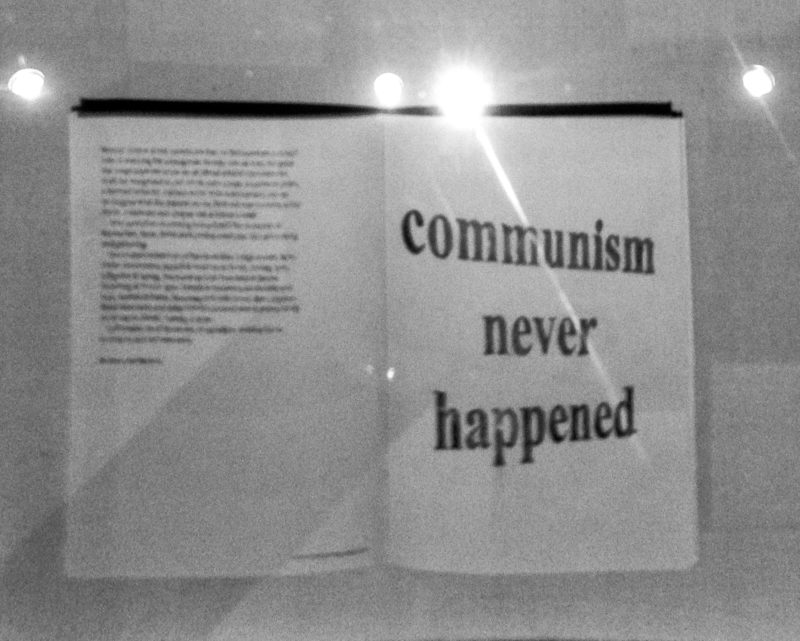Gedanken zum Arttalk des Symposiums Featuring Kaisersteinbruch #2
März 2017
Wenn wir an Sprache denken, so ist es zuerst einmal das Verbale, das uns in den Sinn kommt – gesprochen oder geschrieben. Gleich danach, erinnern wir uns eventuell an das Nonverbale: an Gestik und Mimik – an die Sprache des Körpers. Vielleicht denken wir dann auch noch an den nationalisierenden Charakter von Sprache; an das länderspezifisch-segmentierende und das bisserl Italienisch, das wir irgendwann in der Schule im Wahlfach gelernt haben. Woran wir jedoch selten denken, ist, dass Sprache das Mittel zwischenmenschlicher Interaktion ist, der kürzeste Weg zwischen Mund und Ohr, Papier und Auge -sofern natürlich gewisse Parameter erfüllt sind. Mund, Ohr und Auge müssen gleich getaktet sein, einfach gesagt, dieselbe Sprache sprechen und selbst das gewährleistet noch kein einvernehmliches Verständnis über den Inhalt von gesendeter und empfangener Nachricht. „Das war so nicht gemeint“ und „Du verstehst mich nicht“ sind schließlich keine Aussagen, die sich auf eine etwaige Fremdartigkeit der benutzten Sprache beziehen.
Wenn wir also, miteinander kommunizieren, verwenden wir im Regelfall dieselbe(n) Sprache(n), zum Teil auch solche von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie beherrschen. Die kanonisierte Sprache konventionalisierter Dinge etwa: der weiße Kaffeebecher aus Papier mit grünem Logo, das weiße Unterhemd, der Damenschuh mit roter Sohle oder das gelb karierte Flanellhemd vermitteln bereits kleine kompakte, vorgefertigte Infopakete über Besitzerin und Besitzer. Auch die Sprache des Informationsdesigns „♀“ oder überhaupt der Symbole des Alltags bereiten uns keine Schwierigkeiten: ein „:-)“, das uns die überschwängliche Freude unserer Gesprächspartner indiziert. Oder die kleine Diskette, die uns unverblümt anzeigt, dass unsere mühsam in die Welt und eine Datei geklopften Gedanken an einem sicheren Ort gespeichert werden können. Das sind klare Aussagen, die weit über alle Landesgrenzen hinaus verstanden werden. Fakt ist, wir sprechen und verstehen „;D“.
Lange Zeit hatten wir auch kein Problem damit zu verstehen, was Kunst uns sagen will. Ihre Sprache zu beherrschen war ein Leichte(re)s, hat sie sich doch eben an den allgemein bekannten Metaphern und gültigen Symbolen des Lebens entlanggehantelt, eine lesbare Ikonographie instrumentalisiert. Wir sehen: beflügelte menschliche Gestalt mit Schwert und wissen: Erzengel Michael, wir schauen einen wunderschönen, paradiesischen Garten und denken: locus amoenus und wir lesen bildlich einen Löwen in einer Bibliothek auf und sind uns sicher: Gott. Auch das Unvermittelte ist leicht verständlich: violetter Olivenhain, roter Himmel ergo Expressionismus: es ist, was es ist mit ein bisschen Interpretation, aber die Farben stimmen. Ab dann wird es schon schwieriger: Frau mit dreiviertel halbiertem Gesicht im Drittel aufgeklappt, das Ohr zusammengefaltet, vor blauem Hintergrund: wir bewerten, wissen, dass das gut ist, geschätzt wird – weil den Namen, den kennt man ja, aber die Mühe zu lernen WARUM machen wir uns schon nicht mehr; die nötige Sprache erlernen wir nicht – wir verstehen kaum noch. Wir sind schon längst nicht mehr polyglott in Kunst und wenn wir nicht jemanden finden, der für uns übersetzt, urteilen wir meist: „entsetzlich!“. Weil wir eben so sind; was wir nicht verstehen, kann uns nicht berühren.
Heute reagiert Kunst auf ein weitaus größeres Informationsspektrum als zu Zeiten der alten Meister. Informationen, die wir aufgrund ihres Volumens schon nicht mehr fassen können, inspirieren Künstlerinnen und Künstler zu Aussagen und Gedanken, die wir meist nicht zu kontextualisieren wissen. Oder sie sprechen derart abstrakt über Gewusstes, dass wir es schlicht und ergreifend nicht aufnehmen können. Ohne nötigen Wortschatz lässt sich dann Gezeigtes nur äußerst schwer entziffern, es wird vielleicht eines der großen, gesellschaftsbewegenden Themen, sicher ist es aber nicht. Was also tun? Weil in der Abstraktion auch immer eine Reduktion stattfindet, die sich auf einen recht basalen Nenner bringen lässt, würde uns ein Kurs in Formensprache ein gutes Rüstzeug für einen Streifzug durch die (aktuelle) Kunstszene anbieten. Die schönste Eigenschaft der Form ist nämlich, dass sie jede Form annehmen kann; sie kann sich ein-, zwei- und sogar dreidimensional als Performanz ausdrücken. Wir lernen also gleich mehrere Dinge auf einmal. Beherrschen wir diese spezielle Art der Grammatik, so können wir verstehen, was uns gesagt wird und uns eine Meinung über den Inhalt der Nachricht bilden und nicht bloß ihren Dialekt oder die Prosodie. Ob wir das Ergebnis – also das Kunstwerk + Message –dann letzten Endes gut, schön, ästhetisch, formvollendet, ansprechend und reizend finden oder nicht, sei dahingestellt. Zumindest können wir jedoch unserem persönlichen Geschmack eine fundiertere Argumentation zur Seite stellen als ein bloßes „so halt“ oder noch schlimmer „[…]“.
Lassen Sie es uns also tun. Bevor unser Verständnis von Kunst beginnt dahinzudümpeln, wie der arme Fetzen Italienisch von anno dazumals: zücken wir unsere Vokabelhefte und lernen wir verstehen was Nitsch so besonders macht und Brancusi in die Riege der Meister erhebt. Spitzen wir unsere Bleistifte, üben die Deklinationen der Linien und Konjugation der Farbe, bis wir die Poesie erkennen, die von ihnen ausgeht, denn es geht nicht bloß um das Schauen, es geht um das Verstehen und wenn wir soweit sind, dass wir das verinnerlicht haben, begreifen wir ganz schnell:
Ohne Sprachen sind wir arm.