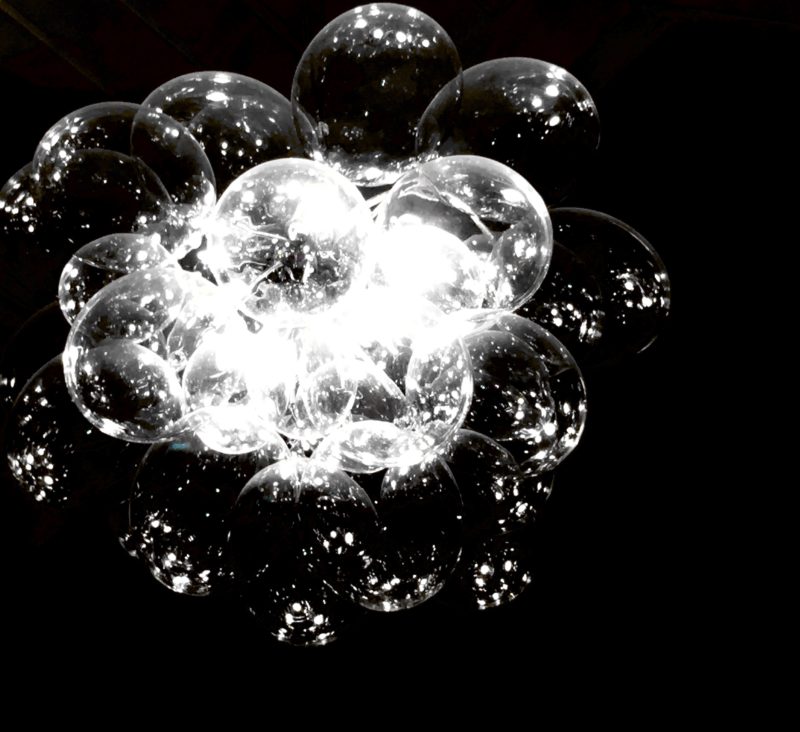Jährlich, am Ende des Sommers, wenn das innere Kind den Schulbeginn in der Magengegend spürt, hilft nur ein Stanitzel Nostalgie, um die nahenden Grauen des nächsten Winters zu verdrängen. Ein Eis vom Tichy und die Welt ist ein, zwei oder drei Kugeln lang in Ordnung. Weil der Reumannplatz gerade renoviert wird und die Bankerlsituation den voyeuristischen Vorstellungen, die man allein mit seinem Eis eben hat, derzeit nicht entspricht, setze ich mich mit meinen gefrorenen Kindheitserinnerungen in die Favoritenstraße und schaue.
Heute ist der 8. September 2020 und die Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat der Öffentlichkeit soeben erklärt, wovor sich Österreich als nächstes zu fürchten hat: der Bildung von Parallelgesellschaften. Sie warnt vor Segregationen à la „Little Italy“ und „Chinatown“ und fürchtet bedrohliche Zustände, ähnlich jenen in den Pariser Banlieus. Was zuerst nach dem von Fakten überforderten amerikanischen Präsidenten klingt, ist irgendwie auch eine Einladung, kulinarisch über Integration nachzudenken. Chinatown und Little Italy: Was sind sie anderes, als die Orte für authentische Küche, gastronomische Kuriositäten und exotische Viktualien? Touristenmagnete und kulinarische Schatzkammern, die ihre Städtebilder genussvoll mitprägen?
Obwohl nun Wien als zentraleuropäische Metropole seinen fairen und sehr populären Anteil an ausgezeichneten, italienischen Restaurants und ebensolchen asiatischen hat, liegt das große Potenzial importierter Gastronomie eigentlich woanders. Während ich mich auf meinem Bankerl um mein Eis kümmere, werden an mir säckeweise frische Melanzani und knackige Zucchini vorbeigetragen, duftende Fladenbrote, hauchzarte Jufkateige und eingelegte Weinblätter, dort milder Ziegenkäse, hier cremige Medjool Datteln. Während ich diesen Köstlichkeiten nachschaue, frage ich mich, warum all das abseits des Naschmarktes nicht eigentlich viel populärer ist. Wie kann es sein, dass in Zeiten von Ottolenghis hedonistischer Breitenwirkung und NENIs Prominenz, in der Bundeshauptstadt nur ein verhältnismäßig schmales, innerstädtisch konzentriertes, Angebot orientalischer Gastronomen*innen bekannt ist? Wien kennt die türkische Küche vornehmlich von den Kebapstandln ums Eck. Libanesische Küche, syrische Küche, serbische und rumänische Küche kaum und befragt man die einschlägigen Gastrokenner*innen (Anm.: Wien wie es isst, Corti, Falstaff, diverse Foodblogger*innen) nach ebensolchen Empfehlungen, wird kein einziges Lokal im 10. Bezirk gelistet. Das verwundert schon, denn am Angebot kann es nicht liegen. Ich habe das Gefühl ich bin umringt von Restaurants, die mir Mezze, Pide oder Gegrilltes servieren möchten und die Türen stehen allen offen. Woran liegt es also? Qualität? Angebot? Atmosphäre? Chic? Warum kommen die Kritiker*innen nicht und kosten sich durch Favoriten abseits von Meixners und Ringsmuth?
Integration wird oftmals als Einbahn gedacht, so, wie viele Herausforderungen oftmals als Einbahn gedacht werden: „Die anderen müssen, weil …“. Nun haben wir hier ein Beispiel, in dem die anderen haben – nämlich eine Existenz begründet und sich durch die Gastronomie in die Gesellschaft eingeschrieben – aber es sitzt immer noch nicht, „weil …“. Es ist wahr, dass die Lokale, die ich beobachte hauptsächlich von den Kindern ihrer Küchen besucht werden. In den Sozialen Medien werden diese Restaurants größtenteils in der Landessprache gepostet und getagged. Wenn uns das stört, sind wir daran aber selbst schuld, weil wir nicht auch hingehen und uns bekochen lassen. Wenn wir hier eine Parallelgesellschaft identifizieren wollten, dann müssten wir auch die Mitschuld der Mehrheitsgesellschaft entlarven, die es nach wie vor verabsäumt ein Inklusionsgesuch anzunehmen. Warum also überhaupt mit dem Finger zeigen, anstatt ihn genüsslich in Cacık (Anm.: Gurkenjoghurt) zu tauchen und den Gaumen die Arbeit machen zu lassen? Wir sind allen eingeladen uns an den Tisch zu setzen. Gedeckt ist er längst.